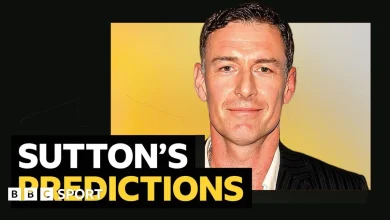Für eine kritische Auseinandersetzung

Keine andere Dokumentation ist aktuell so im Gespräch wie die auf Netflix über Haftbefehl, in der es schonungslos um Drogenexzesse, Straßenkriminalität, eine schwierige Familiengeschichte, Depression und Suizid geht. In Hessen fordern Schüler, dass Musik und Leben des Rappers Unterrichtsstoff werden sollen, weil es ihrer Meinung nach um Identität und gesellschaftliche Probleme gehe. Sie bezeichnen Haftbefehl als „Teil der kulturellen DNA“ und haben bundesweit eine Debatte ausgelöst.
„Schule muss lebensnah sein – denn sie ist immer auch Spiegel der Gesellschaft“, sagt Dr. Torsten Habbel, Leiter der Anne-Frank-Gesamtschule. „Der Wunsch der Schüler*innen, der aktuell bundesweit diskutiert wird, fordert diesen Lebensweltbezug ein. Das ist nachvollziehbar und keineswegs neu.“ Der verbindliche Lehrplan denke laut Habbel in größeren Kontexten als in tagesaktuellen Themen. „Ob die in diesen Tagen intensiv diskutierte Netflix-Dokumentation noch in fünf Jahren gesehen wird, muss sich zeigen. Goethe hingegen hat schon vor über 200 Jahren Themen angesprochen, die auch heute aktuell sind. Dennoch steht auch Goethe aktuell nicht im Lehrplan“, so der Schulleiter. „Haftbefehl ist nach meiner Einschätzung kein Vorbild – aber er spiegelt gesellschaftliche Realität wider. Es geht um Einordnung, Kontextualisierung und kritisches Nachdenken. Dies kann beispielhaft an seinen Texten und Liedern in verschiedenen Unterrichten erarbeitet werden und das geschieht auch an unserer Schule.“
In Deutsch sei das Aktuellste „Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen“. „In diesem Zuge besprechen wir Social Media, politische Reden, auch Poetry Slams. Da passt die Beschäftigung mit Haftbefehl auf jeden Fall hinein“, wie Deutschlehrerin Alexandra Revering findet. Anna-Lena Treese, Kunst- und Philosophielehrkraft, habe mit ihren Schülern über Haftbefehl gesprochen. „Wir sprachen auch darüber, dass Haftbefehl einige sehr fragwürdige Haltungen vertrat und vertritt“ – wie beispielsweise zu Drogen, Antisemitismus und Sexismus. „Das war den meisten zwar klar, muss dann aber immer mit thematisiert werden“, sagt sie. Viele Raptexte seien aus Sicht von Deutsch- und Philosophielehrerin Melanie Meier-Hajek in ihrer Komplexität und Länge eher schwer für eine vollständige Analyse oder Klassenarbeit geeignet. „Sie bieten sich jedoch gut an, um unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema sichtbar zu machen und Diskussionen anzuregen“, sagt sie. Wichtig sei dabei, die Textauswahl sorgfältig zu treffen, da gerade bestimmte Subgenres problematische Inhalte, etwa antisemitische, sexistische, homofeindliche oder rassistische Aussagen, die Gewalt gegenüber Frauen oder Drogenkonsum verherrlichen würden sowie demokratiefeindliche Tendenzen hätten. „Diese Ebene muss man unbedingt mitdenken, bevor man Künstler*innen oder Songs in den Unterricht integriert“, betont sie. „Gleichzeitig gibt es aber auch Rapper*innen, die bewusst andere Werte vertreten und sich kritisch mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Gerade weil Rap sprachlich und inhaltlich oft vielschichtig und provokant ist, sollte die Einbindung in den Unterricht gut überlegt und pädagogisch reflektiert sein.“